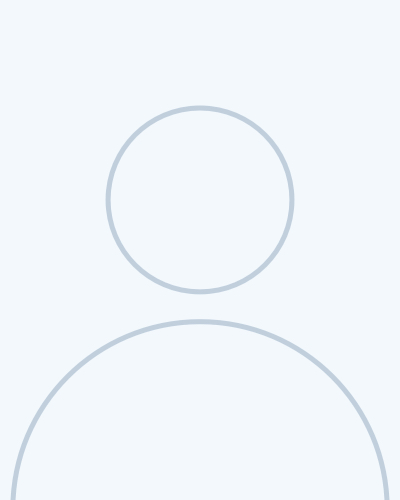Mietkaufmodell und andere Lösungen
Auch wenn sich Käufer und Verkäufer für ein Grundstück gefunden und geeinigt haben, kann der Kaufvertrag manchmal noch nicht sofort abgeschlossen werden. Hindernisse für einen sofortigen Kaufvertrag können seitens des Käufers als auch seitens des Verkäufers bestehen. Der Käufer erhält manchmal die Finanzierung noch nicht und muss das Eigenkapital erst ansparen oder er will abwarten, ob er eine Baugenehmigung bekommt. Manchmal will der Käufer auch nur etwas Zeit haben, um sich den Kauf zu überlegen.
Der Verkäufer dagegen will den Abschluss des Kaufvertrags hinausschieben, wenn die 10-jährige Spekulationsfrist des § 23 EStG noch nicht abgelaufen ist, um den Veräußerungsgewinn nicht versteuern zu müssen.
Zur Lösung des Problems bestehen verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten: Man kann ein Rücktrittsrecht vereinbaren, den Vertrag unter einer aufschiebenden Bedingung abschließen oder aber lediglich ein Ankaufsrecht oder ein Andienungsrecht vereinbaren. Die steuerlichen Rechtsfolgen sind unterschiedlich.
Die Spekulationsfrist des § 23 EStG
Solange die 10-jährige Spekulationsfrist des § 23 EStG noch nicht abgelaufen ist, darf man den notariellen Kaufvertrag nicht abschließen. Im Internet liest man zwar den schlauen Rat, dass man einen Vorvertrag abschließen kann. Allerdings bleibt dabei unklar, was genau unter einem „Vorvertrag“ zu verstehen ist.
Nach § 23 EStG wird die Steuerpflicht des Veräußerungsgewinns dadurch ausgelöst, dass das Grundstück innerhalb der Frist von 10 Jahren seit der Anschaffung veräußert wird. Dabei ist unter Veräußerung der schuldrechtliche Kaufvertrag zu verstehen, durch den beide Parteien zivilrechtlich wirksam verpflichtet werden. Dies ist der Kaufvertrag, der beim Notar unterschrieben wird. Der Übergang von Nutzen und Lasten und die Umschreibung des Eigentums sind für die Spekulationsfrist unerheblich. Ein nur privatschriftlich abgeschlossener Kaufvertrag, der mangels Beurkundung zivilrechtlich unwirksam ist, löst noch keine Steuerpflicht aus. Allerdings kann man aus einem solchen Vertrag auch keine Rechte herleiten, sodass sich dies nicht als Gestaltung anbietet.
Die Steuerpflicht kann man auch dadurch vermeiden, dass man einen Kaufvertrag abschließt, durch den nur eine der beiden Parteien verpflichtet wird. Wird nur der Käufer zum Kauf verpflichtet, spricht man von einem Andienungsrecht des Verkäufers, wird nur der Verkäufer verpflichtet, von einer Ankaufsoption des Käufers. Die fehlende rechtliche Verpflichtung der anderen Vertragspartei ersetzt man in diesen Fällen üblicherweise durch einen wirtschaftlichen Anreiz.
Ankaufsoption
Wird beispielsweise nur der Verkäufer zum Abschluss des Kaufvertrages verpflichtet, kann man einen wirtschaftlichen Anreiz des Käufers zum Ankauf dadurch herstellen, dass der Käufer eine Anzahlung auf den Kaufpreis zahlt, die verfällt, wenn er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt von seinem Ankaufsrecht keinen Gebrauch macht.
Will der Käufer schon in das Objekt einziehen, bietet es sich an, eine höhere Miete zu vereinbaren. Dies stellt einen gewissen Druck auf den Kaufinteressenten dar, möglichst bald von seinem Ankaufsrecht Gebrauch zu machen. Allerdings sollte man die mietrechtlichen Vorschriften beachten und jedenfalls keine Wuchermiete vereinbaren. In vielen Gegenden gilt auch die Mietpreisbremse. Zwar gibt es für Einfamilienhäuser keine Mietspiegel. Dennoch gilt die Mietpreisbremse, sodass die Miete nicht mehr als 10 Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf.
Zivilrechtlich gestaltet man den Vertrag in der Weise, dass der Verkäufer vor dem Notar ein bindendes Angebot zum Abschluss des Kaufvertrags abgibt, das der Kaufinteressent innerhalb einer bestimmten Frist annehmen kann. Die Konditionen des Kaufvertrags müssen dabei genau bestimmt werden. Obwohl der Vertrag nur den Verkäufer bindet, muss er gem. § 311 b Abs. 1 Satz 1 BGB notariell beurkundet werden. Dies gilt auch für den Mietvertrag, da er eine untrennbare Einheit mit dem Kaufvertrag bildet.
In steuerrechtlicher Hinsicht ist zu bedenken, dass bei Vereinbarung einer höheren Miete diese von dem Eigentümer als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung zu versteuern ist. Wird ein eigenständiges Entgelt für das Optionsrecht vereinbart, ist dieses von einem privaten Verkäufer als Entgelt für eine sonstige Leistung nach § 22 Nr. 3 EStG zu versteuern. Wird das Entgelt als Vorauszahlungen auf den Kaufpreis vereinbart, die bei Nichtausübung des Ankaufsrechts verfällt, handelt es sich bei einem privaten Verkäufer ebenfalls um Entgelt für eine sonstige Leistung, wenn die Vorauszahlung verfällt. Kommt es zum Abschluss des Kaufvertrags, gehört die Vorauszahlung zur Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer. Die Grunderwerbsteuer entsteht jedoch erst bei Ausübung der Ankaufsoption, da erst dann der Kaufvertrag zustande kommt.
Andienungsrecht
Denkbar ist auch der umgekehrte Fall, dass der Käufer sich zum Ankauf verpflichtet und der Verkäufer sich das Recht vorbehält, das Kaufangebot anzunehmen. Sinnvoll ist diese Gestaltung insbesondere, wenn die Spekulationsfrist noch nicht abgelaufen ist und der Verkäufer sicherstellen will, dass der Kaufvertrag erst nach Ablauf der 10 Jahre zustande kommt. Auch bei dieser Gestaltung kann man dem Kaufinteressenten das Objekt schon vorher vermieten. Allerdings darf der Mietvertrag nicht so ausgestaltet werden, dass schon ein Lastenwechsel stattfindet und die Sachgefahr auf den „Erwerber“ übergeht. Denn in solchen Fällen hat die Rechtsprechung bereits das Verkaufsangebot als Veräußerung gewertet, weil das wirtschaftliche Eigentum auf den Erwerber übergegangen ist.
Damit der Vermieter ein Interesse hat, den Verkauf abzuschließen, muss die Miete in diesem Fall niedriger sein als üblich. Solange die Miete die Grenze des § 21 Abs. 2 EStG nicht unterschreitet und mindestens 50 Prozent der ortsüblichen Marktmiete beträgt, hat der Vermieter keinen steuerlichen Nachteil und kann die Werbungskosten in vollem Umfang abziehen.
Dauert es bis zum Ablauf der 10-jährigen Spekulationsfrist nicht mehr lange, kann der Verkäufer den Kaufvertrag auch zunächst von einem Vertreter ohne Vertretungsmacht abschließen lassen. Üblicherweise wird hiermit eine Angestellte im Büro des Notars beauftragt. Für die Berechnung der Spekulationsfrist wird die Veräußerung in diesem Fall erst wirksam, wenn der Eigentümer den Vertrag genehmigt. Zwar wirkt eine Genehmigung nach § 184 Abs. 1 BGB grundsätzlich auf den Zeitpunkt des Vertragsabschlusses zurück. Steuerlich gilt die Rückwirkung jedoch nicht, wenn es sich um die Genehmigung des Verkäufers handelt. Bei Berechnung, ob die Spekulationsfrist bereits abgelaufen ist, muss man dies auch für den Zeitpunkt des Ankaufs beachten: Ist der Vertrag übe den Ankauf des Grundstücks mit Hilfe eines vollmachtlosen Vertreters abgeschlossen worden, beginnt die 10-jährige Spekulationsfrist erst mit der Erteilung der Genehmigung durch den Eigentümer. Andere Genehmigungen – etwa durch eine Behörde – haben dagegen auch im Hinblick auf § 23 EStG Rückwirkung. Die Grunderwerbsteuer entsteht gem. § 14 Nr. 2 GrEStG erst mit Erteilung der Genehmigung. Dies gilt auch für die Genehmigung durch den Eigentümer.
Rücktrittsrecht
In Fällen, in denen der Käufer noch nicht sicher ist, ob er für das Grundstück eine Baugenehmigung erhält, wird üblicherweise ein Rücktrittsrecht vereinbart. Sollte die Spekulationsfrist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelaufen sein, ist der Veräußerungsgewinn steuerpflichtig, weil der Kaufvertrag für beide Seiten bindend und sofort wirksam ist.
Der Nachteil einer solchen Gestaltung besteht vor allem darin, dass die Grunderwerbsteuer sofort mit Abschluss des Vertrags entsteht und auch fällig ist. Bei einem Rücktritt wird die Grunderwerbsteuer gem. § 16 Abs.1 Nr. 1 GrEStG nur dann aufgehoben, wenn der Rücktritt innerhalb von zwei Jahren stattfindet. Empfehlenswert ist es deshalb, den Vertrag in solchen Fällen unter einer aufschiebenden Bedingung abzuschließen. Denn gem. § 14 Nr. 1 GrEStG entsteht die Grunderwerbsteuer erst mit Eintritt der Bedingung.
Reservierungsvereinbarung
Etwas ganz anderes sind bloße Reservierungsvereinbarungen. Dabei handelt es sich lediglich um eine Vereinbarung zwischen dem Makler und dem Kaufinteressenten, in der sich der Makler verpflichtet, die Immobilie für einen bestimmten Zeitraum keinem anderen Interessenten anzubieten. Verbreitet sind solche Verträge insbesondere beim Vertrieb von Neubauwohnungen. Bei Abschluss des Kaufvertrages soll die Reservierungsgebühr auf den Kaufpreis angerechnet werden. Wenn der Kaufinteressent sich nicht zu dem Kauf entschließt, soll die Reservierungsgebühr in der Regel verfallen.
Gesetzliche Regelungen hierfür gibt es nicht. Grundsätzlich darf die Reservierungsgebühr nicht mehr als 10 – 15 Prozent der Maklergebühr betragen. Anderenfalls wäre der wirtschaftliche Druck auf den Kaufinteressenten so hoch, dass eine Beurkundung des Vertrags nach § 311 b BGB erforderlich wäre. Nach der Rechtsprechung muss der Vertrag außerdem individuell ausgehandelt werden, wenn die Gebühr verfällt, falls es nicht zum Abschluss des Kaufvertrags kommt. Hat der Eigentümer dem Makler einen Alleinauftrag erteilt, ist seine Zustimmung erforderlich.
Der Kaufinteressent muss bedenken, dass er durch die Reservierung keinen Anspruch auf Abschluss des Kaufvertrags erhält und der Eigentümer das Objekt möglicherweise sogar trotzdem an einen anderen Interessenten verkaufen könnte.