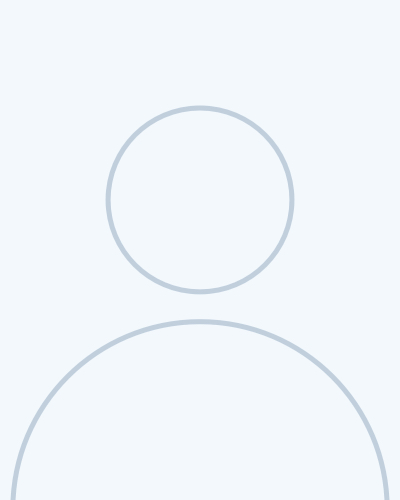Am 21. August 2025 hat das BMF eine Neufassung des Schreibens zur Förderung energetischer Maßnahmen an zu eigenen Wohnzwecken genutzten Gebäuden veröffentlicht. In weiten Teilen wird das bisherige Schreiben vom 21.1.2021 übernommen. Für die Anforderungen an die Bescheinigung des Fachunternehmens, die mit dem Antrag eingereicht werden muss, gilt weiterhin das BMF-Schreiben vom 23.12.
In dem Schreiben werden vor allem folgende Themen geklärt:
- Begünstigtes Objekt,
- Anspruchsberechtigte Person,
- Nutzung zu eigenen Wohnzwecken,
- Alter des Objekts,
- Unterschiedliche Nutzung einzelner Gebäudeteile,
- Wohnungseigentümergemeinschaften,
- Förderfähige Aufwendungen,
- Nachweis der energetischen Maßnahme,
- Rechnung und Zahlung,
- Antragstellung.
Das Schreiben vom 21.1.2021 enthielt eine Liste der förderfähigen Maßnahmen, die jedoch nicht abschließend war. Diese Liste ist deutlich erweitert worden, u.a. durch den Unterpunkt „Sommerlicher Wärmeschutz“. Neu aufgenommen wurde ein Hinweis auf nicht förderfähige Anlagen wie z. B. PV-Anlagen, Stromspeicher und Wechselrichter.
Abzug von der Steuerschuld
Wer energetische Baumaßnahmen an einem vermieteten Gebäude durchführt, kann die Kosten als Werbungskosten von den Mieteinnahmen abziehen. Wird die Wohnung zu eigenen Wohnzwecken genutzt, können die Kosten gem. § 35 c EStG zu einem bestimmten Prozentsatz von der Steuerschuld abgezogen werden. Dadurch wird erreicht, dass die Auswirkung unabhängig von der Höhe des persönlichen Steuersatzes ist. Anders als bei § 35 a EStG werden nach § 35 c EStG aber nicht nur die Lohnkosten, sondern auch Materialkosten gefördert. Der Steuerpflichtige muss die Steuerermäßigung im Rahmen der Einkommensteuererklärung in der Anlage „Energetische Maßnahmen“ beantragen.
Förderhöchstbetrag
Im Jahr des Abschlusses der Baumaßnahme und im 1. Folgejahr können 7 Prozent der Kosten, im 2. Folgejahr 6 Prozent abgezogen werden. Pro Objekt ist die Bemessungsgrundlage für die Steuerermäßigung auf 200.000 Euro begrenzt, sodass die Förderung höchstens 40.000 Euro beträgt.
| Baukosten | 100.000 € | 200.000 € | 300.000 € |
| Abzug im Jahr des Abschlusses | 7.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| Abzug im 1. Folgejahr des Abschlusses | 7.000 € | 14.000 € | 14.000 € |
| Abzug im 2. Folgejahr des Abschlusses | 6.000 € | 12.000 € | 12.000 € |
| Summe | 20.000 € | 40.000 € | 40.000 € |
Übersteigt die Steuerermäßigung nach § 35 c EStG die tarifliche Einkommensteuer, kann der Abrechnungsüberhang nicht in andere Veranlagungszeiträume vor- oder zurückgetragen werden. Auch eine andere Verteilung innerhalb des dreijährigen Förderzeitraums ist nicht möglich. Dadurch werden Kleinverdiener benachteiligt.
Begünstigte Baumaßnahmen
Begünstigt sind alle Maßnahmen, die der Energetische-Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) entsprechen. Dies sind im Wesentlichen:
- die Wärmedämmung von Wänden, Dachflächen und Geschossdecken,
- die Erneuerung von Fenstern, Außentüren und Heizungsanlagen,
- die Erneuerung/ der Einbau einer Lüftungsanlage,
- Erneuerung der Heizungsanlage,
- der Einbau von digitalen Systemen zur energetischen Betriebs- und Verbrauchsoptimierung,
- die Optimierung bestehender Heizungsanlagen, die älter als zwei Jahre sind.
In einer Anlage enthält das BMF-Schreiben eine Liste der förderfähigen Baumaßnahmen, die jedoch nicht abschließend ist. Neu wurde in das BMF-Schreiben eine Auflistung der förderfähigen Maßnahmen im Zusammenhang mit dem sommerlichen Wärmeschutz aufgenommen (Nr. 4 a der Anlage). Diese Maßnahmen war in dem Vorgängerschreiben noch nicht enthalten, weil der erstmalige Einbau oder der Ersatz von außenliegendem sommerlichem Wärmeschutz erst nachträglich mit Wirkung zum 1.1.2021 in die Energetische-Sanierungsmaßnahmen-Verordnung (ESanMV) eingefügt wurde.
Änderungen gegenüber dem Vorgängerschreiben haben sich bei den Maßnahmen im Zusammenhang mit der Erneuerung oder dem Einbau einer Lüftungsanlage (Nr. 5 der Anlage) und der Erneuerung der Heizungsanlage (Nr. 6 der Anlage) ergeben. Hier wird die Abgrenzung der förderfähigen Heizungsanlagen vertieft und insbesondere die Unterscheidung zwischen begünstigter solarer Wärmeerzeugung (Solarthermie) und nicht begünstigter Stromerzeugung (Photovoltaikanlage) unterstrichen. Für Hybridanlagen sieht das BMF-Schreiben eine vereinfachte Aufteilung vor.
Energieberater
Die Beauftragung eines Energieberaters ist nicht erforderlich. Wird ein Energieberater beauftragt, können die Kosten für die Energieberatung im Jahr des Abschlusses der Maßnahmen einmalig mit 50 Prozent von der Steuerschuld abgezogen werden.
Photovoltaikanlagen
Die Installation einer Photovoltaikanlage ist nicht begünstigt (vgl. Anlage 6 zu § 1 ESanMV). Ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Gebäude bleibt allerdings auch dann ein begünstigtes Objekt, wenn auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installiert wird und mit der Anlage aufgrund des Überschreitens der Grenze des § 3 Nr. 72 EStG gewerbliche Einkünfte erzielt werden.
Wird im Zuge der Installation einer Photovoltaikanlage das Dach saniert, sind die Aufwendungen in vollem Umfang nach § 35 c EStG begünstigt. Ein anteiliger Abzug der Aufwendungen als Betriebsausgaben bei den gewerblichen Einkünften aus der Photovoltaikanlage ist nicht zulässig, da eine Aufteilung nicht möglich ist (Rz. 17).
Begünstigtes Objekt
Das Gebäude muss innerhalb der EU oder des ERW liegen.
Begünstigt ist ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Gebäude. Daher sind nicht nur Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen begünstigt, sondern auch Wohnungen in anderen Gebäuden (Rz. 1). Zu dem begünstigten Objekt gehören auch die Zubehörräume wie Kellerräume, Bodenräume etc.
Wird ein Gebäude erweitert, können auch die an dem neuen Wohnraum vorgenommenen Maßnahmen nach § 35 c EStG begünstigt sein. Für die Anwendung des § 35 c EStG ist deshalb unerheblich, ob die die Sanierungskosten nach den allgemeinen Grundsätzen als Erhaltungs- oder Herstellungskosten zu beurteilen sind.
Nach Auffassung der Finanzverwaltung müssen die zu eigenen Wohnzwecken genutzten Räume eine Wohnung i.S. des § 181 Abs. 9 BewG bilden (Rz. 4). Dies ist nach dem Gesetzeswortlaut jedoch nicht erforderlich, sodass m.E. auch ein selbstbewohnter Raum in einem ansonsten vermieteten oder beruflich genutzten Gebäude begünstigt ist. Die Finanzverwaltung führt diese Auffassung aber konsequent fort, indem sie als Förderobjekt die selbstgenutzte Wohnung und nicht das Gebäude versteht. Daher können in einem Mehrfamilienhaus mehrere förderfähige Objekte anerkannt werden (vgl. Rz. 35).
Alter des Objekts
Das Gebäude muss bei Beginn der energetischen Maßnahme älter als zehn Jahre sein (§ 35c Abs. 1 S. 2 EStG). Maßgebend ist der Beginn der Herstellung des Gebäudes. Bei Gebäuden, für die eine Baugenehmigung erforderlich ist, ist dies der Tag, an dem der Bauantrag gestellt wurde. Bei baugenehmigungsfreien Objekten der Tag, an dem die Bauunterlagen eingereicht wurden. Die Frist ist taggenau zu berechnen.
Ist das Gebäude vor dem Jahr 2010 errichtet worden, genügt es, in der Einkommensteuererklärung das Jahr der Herstellung anzugeben, wenn der Tag der Bauantragstellung nicht bekannt ist (Rz. 24). Als Beginn der energetischen Maßnahmen gilt der Tag, an dem der Bauantrag gestellt wurde, bei baugenehmigungsfreien Maßnahmen der Tag, an dem die Bauunterlagen eingereicht wurden. Ist für die energetischen Maßnahmen weder eine Baugenehmigung noch eine Bekanntgabe nach dem Bauordnungsrecht erforderlich, ist der Zeitpunkt des tatsächlichen Beginns der Maßnahme maßgeblich. Dies gilt auch dann, wenn für die Maßnahme eine Anzeige- oder Genehmigungspflicht nach anderen Vorschriften besteht. Planungs- und Beratungsleistungen sowie Liefer- und Leistungsverträge gelten nicht als Beginn der Maßnahmen (Rz. 25).
Miteigentum
Der Förderhöchstbetrag von 40.000 Euro ist objektbezogen. Gehört das Objekt mehreren Eigentümern als Miteigentümer, kann der Höchstbetrag der Steuerermäßigung von 40.000 Euro daher nur einmal in Anspruch genommen werden (Rz. 33). Die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen und der Förderhöchstbetrag sind den Miteigentümern nach dem Verhältnis ihrer Miteigentumsanteile zuzurechnen. Handelt es sich bei den Miteigentümern um Ehegatten oder Lebenspartner, die zusammen veranlagt werden, ist eine Aufteilung nicht erforderlich.
Wird das Objekt nicht von allen Miteigentümern zu eigenen Wohnzwecken genutzt, sind nur die Aufwendungen begünstigt, die nach dem Verhältnis der Miteigentumsanteile auf den Miteigentümer entfallen, der das Objekt selbst nutzt.
Miteigentum bei Zwei- oder Mehrfamilienhäusern
Besteht das Miteigentum an einem Mehrfamilienhaus mit mehreren nicht nach dem WEG getrennten Wohnungen und nutzt jeder der Eigentümer eine Wohnung allein zu eigenen Wohnzwecken, wird jede Wohnung als ein Objekt behandelt. Jedem Miteigentümer steht daher für die von ihm bewohnte Wohnung der Förderhöchstbetrag von 40.000 Euro zu (Rz. 35).
Nutzung zu eigenen Wohnzwecken
Gemischte Nutzung
Werden Teile des Objekts nicht zu eigenen Wohnzwecken, sondern beruflich genutzt oder vermietet, ist dies für die Steuerermäßigung nach § 35 c EStG unschädlich. In diesem Fall sind jedoch die Aufwendungen für die energetischen Maßnahmen um den Teil zu kürzen, der auf die Räume entfällt, die nicht zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden. Bei einem Arbeitszimmer ist unerheblich, ob die Kosten in der tatsächlichen Höhe oder gem. § 4 Abs. 5 Satz 1 EStG Nr. 6 b i.V. mit § 9 Abs. 5 EStG mit der Jahrespauschale von 1.260 Euro berücksichtigt werden.
Zeitweise Selbstnutzung
Ein Objekt wird zu eigenen Wohnzwecken genutzt, wenn es zumindest zweitweise vom Eigentümer selbst bewohnt wird. Daher sind auch Ferienwohnungen begünstigt sowie Objekte, die in Rahmen einer doppelten Haushaltsführung genutzt werden.
Zeitweise Vermietung
Wird die Wohnung zeitweise entgeltlich vermietet, kann für dieses Jahr die Steuervergünstigung des § 35 c EStG nicht in Anspruch genommen werden. Dies gilt auch, wenn nur Teile der Wohnung vermietet werden. Lediglich für die nur vorübergehende Vermietung von Teilen der Wohnung enthält das BMF-Schreiben in Tz 16 eine Billigkeitsregelung für den Fall, dass die Einnahmen nicht mehr als 520 Euro betragen und nach R 21.2 Abs. 1 EStR nicht besteuert werden.
Kauf des Objekts
Die Steuerermäßigung nach § 35 c EStG kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige bei Durchführung der Maßnahmen Eigentümer des Objekts ist und dieses zu eigenen Wohnzwecken nutzt.
Eigentümer
Zivilrechtlicher Eigentümer ist derjenige, der als Eigentümer des Grundstücks im Grundbuch eingetragen ist. Mieter sind nicht anspruchsberechtigt. Wer ein Grundstück gekauft hat, ist nach dem Übergang von Nutzen und Lasten zur Inanspruchnahme der Begünstigung berechtigt, weil er als wirtschaftlicher Eigentümer gilt (Rz. 5). Nießbrauchsberechtigte sind in der Regel nicht anspruchsberechtigt. Eine Ausnahme muss m.E. jedoch für den Vorbehaltsnießbraucher gelten, da dieser bei einem vermieteten Objekt weiterhin als wirtschaftlicher Eigentümer behandelt wird.
Selbstnutzung
Grundsätzlich sind nur Aufwendungen begünstigt, die ab dem Tag der erstmaligen Nutzung zu eigenen Wohnzwecken entstanden sind. Hat der Steuerpflichtige eine Wohnung zur Selbstnutzung gekauft, sind auch Maßnahmen begünstigt, die bereits vor dem Einzug durchgeführt werden, wenn die Wohnung zu diesem Zeitpunkt nicht mehr vermietet ist, sondern leer steht (Rz. 20). Dies gilt auch bei einem längeren Leerstand, wenn die Baumaßnahmen sich über mehrere Jahre hinziehen und der Leerstand durch die Baumaßnahmen bedingt ist (Rz. 12).
War der Käufer bisher Mieter des Objekts, sind die Maßnahmen begünstigt, die ab dem Tag des Lastenwechsels durchgeführt werden (Rz. 20).
Die von dem Verkäufer aufgewendeten Kosten sind dagegen nicht begünstigt.
Verkauft ein Miteigentümer seinen Anteil an den verbleibenden Miteigentümer kann dieser nur die auf seinen Anteil entfallende Steuerermäßigung fortführen. Das gilt auch wenn ein Ehegatte bzw. Lebenspartner den Anteil des anderen etwa im Rahmen einer Scheidung hinzuerwirbt.
Schenkung des Objekts
Überträgt ein Steuerpflichtiger das Objekt während des dreijährigen Abzugszeitraums unentgeltlich auf eine andere Person, kann der Erwerber die Steuerermäßigung des § 35 c EStG nicht fortführen, da er keine Aufwendungen i.S. des § 35 c EStG getragen hat.
Erbfall
Im Erbfall kann der Erwerber des Objekts die Steuerermäßigung des Erblassers nach § 35 c EStG fortführen, wenn er das Objekt zu eigenen Wohnzwecken nutzt.
Fachgerechte Durchführung
Von einer fachgerechten Durchführung ist auszugehen, wenn die energetische Maßnahme von einem Fachunternehmen gem. § 2 Abs. 1 ESanMV vorgenommen wurde. Die fachgerechte Durchführung ist auch in den Fällen zu bejahen, in denen ein angestellter Meister der genannten Gewerke mit der Durchführung betraut war.
Der fachgerechten Durchführung steht nicht entgegen, dass das Fachunternehmen mit der Durchführung einzelner Arbeiten ein Unternehmen unterbeauftragt, das nicht in den in § 2 Abs. 1 ESanMV aufgeführten Gewerken tätig ist, z. B., weil dieses Unternehmen über spezielle Fertigkeiten in einem bestimmten Bereich verfügt. Die fachgerechte Durchführung liegt auch dann vor, wenn ein Generalunternehmer als Vertragspartner des Steuerpflichtigen das Fachunternehmen mit der Ausführung der energetischen Maßnahmen beauftragt hat.
Umfeldmaßnahmen
Begünstigt sind auch Umfeldmaßnahmen, die zur Vorbereitung und Umsetzung der Maßnahme sowie für ihre Funktionsfähigkeit erforderlich sind. Hiermit kann der Steuerpflichtige das Fachunternehmen oder ein anderes Unternehmen beauftragen. Eine Liste der typischen Umfeldmaßnahmen ist in der Rz. 60 enthalten. Welche Maßnahmen nicht als Umfeldmaßnahmen begünstigt sind, ergibt sich aus Rz. 61.
Aufwendung für Umfeldmaßnahmen, die nicht durch das Fachunternehmen ausgeführt werden, sind nur förderfähig, wenn sie in der Bescheinigung des Fachunternehmens gesondert ausgewiesen sind.
Erwirbt der Steuerpflichtige das Material für die Maßnahmen separat, werden die Aufwendungen nur dann als begünstigt anerkannt, wenn diese in der Bescheinigung des Fachunternehmens gesondert ausgewiesen sind.
Keine Kumulation
Die Steuerermäßigung nach § 35 c EStG ist ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen für die energetische Maßnahme bereits als Betriebsausgaben oder Werbungskosten, Sonderausgaben oder außergewöhnliche Belastung berücksichtigt worden sind. Außerdem ist die Steuerermäßigung ausgeschlossen, wenn für dieselbe Maßnahme
- eine Steuerbegünstigung nach § 10 f EStG,
- eine Steuerermäßigung nach § 35 a EStG oder
- ein zinsverbilligtes Darlehen oder ein steuerfreier Zuschuss
beansprucht werden (Rz. 70). Selbst wenn die (einheitliche) energetische Maßnahme nur teilweise öffentlich gefördert wird, ist eine anteilige Gewährung der Steuerermäßigung ausgeschlossen. Unschädlich für die Steuerermäßigung ist nur der Erhalt eines Zuschusses für die kosten eines Energieberaters. Eigentümer, die versäumt haben, bei der Planung staatliche Zuschüsse zu beantragen, können die Kosten aber nachträglich in ihrer Steuererklärung angeben.
Nachweis, Rechnung und Zahlung (Rz. 73 – 84)
Die Steuerermäßigung setzt folgendes voraus:
- Rechnung des Leistungserbringers,
- vollständige Bescheinigung des Fachunternehmensnach § 31 c Abs. 1 Satz 7 EStG und
- Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers (Rz. 73).
Der dreijährige Förderzeitraum beginnt erst mit dem Abschluss der Maßnahme. Die Vereinbarung einer Ratenzahlung und Leistung der ersten Rate im Jahr der Bauleistungen genügt nicht (BFH, Urt. v. 13.8.2024 – IX R 31/23, BStBl. 2024 II, 869.
Nachweis der energetischen Maßnahmen
Energetische Maßnahmen sind durch ein vom Fachunternehmen (Rz. 48 ff) nach amtlich vorgeschriebenem Muster erstellte Bescheinigung nachzuweisen (Rz. 73). Die Bescheinigung ist zusammen mit der amtlichen Anlage „Energetische Maßnahmen“ beim Finanzamt einzureichen. Die umfangreichen formalen Anforderungen an die Bescheinigungen können dem BMF-Schreiben vom 23.12.2024 entnommen werden, das weiterhin gültig ist.
Nachweis der energetischen Maßnahmen
Die Steuerermäßigung kann nur in Anspruch genommen werden, wenn der Steuerpflichtige für die Aufwendungen eine Rechnung in deutscher Sprache erhalten hat und die Zahlung auf das Konto des Leistungserbringers erfolgt ist (Rz. 75).
Antragstellung und Verfahren
Die Steuerermäßigung ist erstmalig in dem Veranlagungszeitraum zu gewähren, in dem die energetische Maßnahme abgeschlossen worden ist.