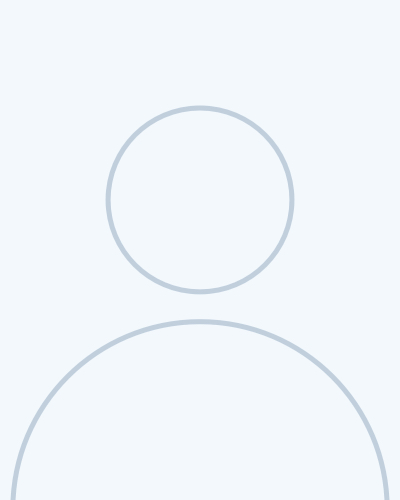Leitsätze
- Überträgt ein Ehegatte unentgeltlich das Familienheim auf eine GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt sind, ist der andere Ehegatte in Höhe des hälftigen Werts des Familienheims schenkungssteuerrechtlich bereichert.
- Auch der Erwerb von Gesamthandseigentum an einem Familienheim wird von der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetzes erfasst.
BFH, Urteil vom 04. Juni 2025, II R 18/23
Der Fall
Der Kläger und seine Ehefrau gründeten eine GbR, an der sie je zur Hälfte beteiligt waren. In der notariellen Urkunde, mit der sie die Gesellschaft gegründet hatten, vereinbarten der Kläger und seine Ehefrau, dass das im Alleineigentum der Ehefrau stehende und von den Eheleuten zu eigenen Wohnzwecken genutzte bebaute Grundstück unentgeltlich in das Gesellschaftsvermögen der GbR übertragen wird. Die hierdurch zugunsten des Klägers bewirkte Berechtigung an dem Grundstück bezeichneten die Vertragschließenden als unentgeltliche ehebedingte Zuwendung der Ehefrau an den Kläger
Das Finanzamt setzte eine Schenkungsteuer in Höhe von 247.000 Euro fest. Die Steuerbefreiung für ein Familienheim nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG sah es wegen der Übertragung des Eigentums an dem Grundstück auf die GbR nicht als einschlägig an.
Der hiergegen erhobenen Klage gab das Finanzgericht statt. Mit der Revision machte das Finanzamt geltend, die Befreiung des § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG erfasse nur das Eigentum oder Miteigentum, nicht aber das Gesamthandseigentum.
Die Entscheidung des BFH
Der BFH hat die Entscheidung des FG bestätigt und zur Begründung folgendes ausgeführt:
Überträgt ein Ehegatte ohne Gegenleistung ein ihm gehörendes Grundstück in das Gesellschaftsvermögen einer GbR, an der beide Ehegatten zu gleichen Teilen beteiligt sind, liegt eine freigebige Zuwendung an den anderen Ehegatten in Höhe des hälftigen Grundstücksanteils nach § 7 Abs.1 Nr.1 ErbStG vor. Unabhängig von der zivilrechtlichen Beurteilung gilt für das Schenkungsteuerrecht nicht die GbR als Gesamthand, sondern der Gesellschafter als Gesamthänder als bereichert. Erwerber und damit Steuerschuldner im Sinne von § 20 ErbStG ist in einem solchen Fall nicht die GbR, sondern der Gesellschafter. Insoweit entspricht der Bedachte im Sinne des Schenkungsteuerrechts (der Gesellschafter) nicht dem Beschenkten im Sinne des Zivilrechts ‑‑die GbR
Dies bedeutet, dass die Ehefrau durch die Übertragung des Familienheims auf die GbR dem Kläger in Höhe seiner hälftigen Beteiligung an der GbR unentgeltlich Eigentum an dem Grundstück verschafft und diesen schenkungsteuerrechtlich in Höhe des hälftigen Grundstückswerts bereichert hat. Damit ist der Tatbestand des §1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 7 Abs. 1 Nr. 1 ErbStG erfüllt.
Das übertragene Grundstück ist als Familienheim zu qualifizieren und wird von der Steuerbefreiung nach § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG erfasst. Zwar setzt § 13 Abs. 1 Nr. 4a Satz 1 ErbStG voraus, dass ein Ehegatte dem anderen Ehegatten durch Zuwendung unter Lebenden „Eigentum“ oder „Miteigentum“ an einem Familienheim verschafft. Der Begriff des „Gesamthandseigentums“ wird in der Vorschrift nicht genannt. Unter die Steuerbefreiung fällt jedoch auch die Zuwendung aufgrund der Einlage des Familienheims durch einen Ehegatten in eine GbR, an der beide Ehegatten als Gesellschafter beteiligt sind. Wenn man unabhängig von der zivilrechtlichen Betrachtung schenkungsteuerrechtlich den an der GbR als Gesellschafter beteiligten Ehegatten als den Bereicherten ansieht, muss man konsequenterweise auch für die Frage, wem durch die Zuwendung Eigentum an dem Familienheim verschafft wird, auf den bereicherten Ehegatten abstellen. Das über die GbR dem Gesellschafter als Beteiligtem am Gesamthandsvermögen zugerechnete Eigentum ist für die Gewährung der Steuerbefreiung ausreichend.
Diese Auslegung wird auch dem Sinn und Zweck des § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG gerecht. Die Vorschrift wurde durch Art. 24 Nr. 2 Buchst. a Doppelbuchst. aa des Jahressteuergesetzes 1996 vom 11.10.1995 (BGBl I 1995, 1250) als Reaktion auf die Rechtsprechung des BFH eingefügt. Der BFH hatte mit Urteil vom 02.03.1994 – IIR 59/92 (BStBl. II 1994, 366) die Steuerfreiheit von ehebedingten unbenannten Zuwendungen aufgegeben. Mit der Änderung des Gesetzes wollte der Gesetzgeber die lebzeitige Zuwendung des Familienheims aus der Besteuerung wieder ausnehmen (BFH-Urteil vom 29.11.2017 – II R 14/16, BStBl. II 2018, 362, Rz 26) und stellte sie durch § 13 Abs. 1 Nr. 4a ErbStG von der Schenkungsteuer frei. Solche Zuwendungen, die den engeren Kern der ehelichen Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft berühren, sollten schenkungsteuerrechtlich privilegiert werden (vgl. BT-Drucks 13/901, S.157). Diesem Sinn und Zweck steht entgegen der Auffassung des FA nicht entgegen, dass der Gesellschafter einer GbR ‑‑anders als ein Alleineigentümer oder ein Miteigentümer nach Bruchteilen‑‑ nach § 719 des Bürgerlichen Gesetzbuchs a.F. nicht über seinen Anteil an dem Gesellschaftsvermögen und an den einzelnen dazugehörenden Gegenständen allein verfügen kann, sondern nur zusammen mit den anderen Gesellschaftern.
Anmerkung
Die Entscheidung hat m.E. auch nach der Verselbständigung der GbR durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (MoPeG) Geltung, weil nach § 2 a ErbStG bei einem Erwerb durch eine rechtsfähige Personengesellschaft deren Gesellschafter als Erwerber gelten.
Eine Übertragung des Familienheims bereits zu Lebzeiten hat verschiedene Vorteile gegenüber dem Erwerb durch Erbanfall. Zwar ist auch im Erbfall der Erwerb des Familienheims durch den länger lebenden Ehegatten von der Erbschaftsteuer befreit. Es gilt§ 13 Abs. 1 Nr. 4 b ErbStG. Bei einem Erwerb des Familienheims im Todesfall entfällt die Steuerbefreiung jedoch rückwirkend, wenn der länger lebende Ehegatte, der das Grundstück erbt, innerhalb von 10 Jahren aus dem Haus auszieht. Nur wenn hierfür zwingende Gründe vorliegen, ist dies unschädlich. Die Erbschaftsteuer entsteht jedoch rückwirkend, wenn der Ehegatte etwa in ein kleineres Objekt umziehen will. Wird das Familienheim dagegen bereits zu Lebzeiten geschenkt, gibt es keine entsprechende Bindung. Schwierig ist die Anwendung der Steuerbefreiung außerdem, wenn der Ehegatte nicht Alleinerbe wird, sondern beispielweise nur zur Hälfte Miterbe neben den Kindern. Denn in diesem Fall erbt er auch das Familienheim zur Hälfte.