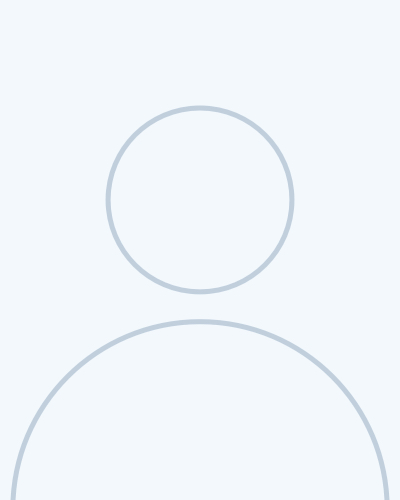Für die neue ab 2025 zu zahlende Grundsteuer ist bei der Betriebskostenabrechnung kein Vorwegabzug der auf die Gewerberäume entfallenden Grundsteuer vorzunehmen. Ist der Grundsteuerwert im Sachwertverfahren ermittelt worden, gibt es für das Gebäude nur einen einheitlichen Wert, der nicht nach der jeweiligen Nutzung einzelner Räume unterscheidet. Das Gleiche gilt aber auch, wenn es sich um ein Mietwohngrundstück handelt und der Grundsteuerwert im Ertragswertverfahren ermittelt worden ist. Auch in diesem Fall ist die unterschiedliche Nutzung der einzelnen Räume unerheblich, weil zur Ermittlung des Rohertrags auch für Gewerberäume die typisierte Miete von Wohnungen nach der Anlage 39 zu § 254 BewG angesetzt wird.
Umlagefähigkeit der Grundsteuer
Die Grundsteuer gehört nach § 2 Nr. 1 Betriebskostenverordnung (BetrKV) zu den Betriebskosten. Sie kann daher auf die Mieter umgelegt werden, wenn dies im Mietvertrag vereinbart ist. Hierfür genügt eine Vereinbarung, dass die Betriebskosten von dem Mieter zu zahlen sind.
Ist das Gebäude an mehrere Mieter vermietet, muss ein Umlageschlüssel vereinbart werden. In der Regel ist der Wohnflächenschlüssel vereinbart, also das Verhältnis der Wohnfläche der jeweiligen Wohnung zu der Gesamtwohnfläche des Gebäudes. Bei Eigentumswohnungen wird häufig das Verhältnis der Miteigentumsanteile vereinbart, weil dies der Aufteilung in der Wohngeldabrechnung des WEG-Verwalters entspricht.
Gemischte Nutzung des Gebäudes
Selbst wenn in einem Gebäude neben Wohnungen auch Gewerberäume vermietet werden, ist die Anwendung des Flächenschlüssels grundsätzlich zulässig, da die gewerbliche Nutzung nicht zwangsläufig zur Entstehung höherer Betriebskosten führt. Ein Vorwegabzug der auf die Gewerberäume entfallenden Betriebskosten ist nur dann erforderlich, wenn eine einheitliche Abrechnung nach dem Flächenmaßstab unbillig wäre und zu einer erheblichen Mehrbelastung der Wohnungsmieter führen würde.
Für die bis zum Jahre 2024 geltende „alte“ Grundsteuer wurde die Ansicht vertreten, dass ein Vorwegabzug der auf die Gewerberäume entfallenden Grundsteuer erforderlich ist, wenn die Belastung der Wohnungsmieter eine bestimmte Grenze überschreitet. Dies ist jedoch für die seit dem Jahre 2025 geltende neue Grundsteuer nicht mehr erforderlich. Da für die neue Grundsteuer nicht mehr der Einheitswert nach den §§ 19 – 109 BewG zugrunde gelegt wird, sondern der Grundsteuerwert nach dem siebenten Abschnitt des BewG, ergibt eine solche Aufteilung keinen Sinn.
Unterschiede zwischen dem Einheitswert und dem Grundsteuerwert
Bis zum Jahre 2024 war Bemessungsgrundlage für die Grundsteuer der Einheitswert nach den §§ 19 – 109 BewG. Wie in dem neuen Recht wurde auch für die Einheitsbewertung in § 75 BewG zwischen den Grundstücksarten Mietwohngrundstücke, Geschäftsgrundstücke und gemischt genutzte Grundstücke in gleicher Weise unterschieden. Wesentlich sind jedoch folgende zwei Unterschiede: Der Einheitswert war für bebaute Grundstücke gem. § 76 Abs. 1 BewG grundsätzlich im Ertragswertverfahren zu ermitteln. Das Sachwertverfahren war für diese Art von Grundstücken (§ 57 Abs. 1 Nr. 1 – 3 BewG) nur in Ausnahmefällen anzuwenden, wenn weder die tatsächliche Miete noch eine übliche Miete ermittelt werden konnte. Da die Miete für Gewerberäume üblicherweise höher ist als für Wohnräume, ergab sich für den gewerblich genutzten Teil des Gebäudes ein höherer Wert. Für die neue Grundsteuer ist der Wert des Grundstücks gem. § 250 Abs. 3 BewG dagegen stets im Sachwertverfahren zu ermitteln, wenn es sich um ein Geschäftsgrundstück oder ein gemischt genutztes Grundstück handelt. Nach diesem Verfahren kommt es für die Ermittlung des Gebäudewertes nicht auf die Höhe der Mieten an, sondern auf das Baujahr und die Gebäudeart. Eine Aufteilung des Grundsteuerwertes auf die gewerblich genutzten Flächen und die Wohnflächen würde keinen Sinn ergeben, weil die unterschiedlichen Nutzungen keine Auswirkung auf den Grundsteuerwert haben und sich deshalb keine unterschiedlichen Werte je Quadratmeter ergeben würden.
Zwar muss man einräumen, dass Wohnungen, die auf einem Nichtwohngrundstück liegen, gegenüber Wohnungen auf einem Mietwohngrundstück benachteiligt sind, weil in diesem Fall das Sachwertverfahren anzuwenden ist. Außerdem haben einige Länder für Nichtwohngrundstücke höhere Steuermesszahlen eingeführt, und in einigen Bundesländern haben die Gemeinden für Nichtwohngrundstücke höhere Hebesätze festgelegt. Dies rechtfertigt es m.E. aber nicht, die sich daraus ergebende stärkere Belastung der Wohnungsmieter auf die Gewerbemieter zu verlagern.
Auch bei Mietwohngrundstücken ist eine Aufteilung der Grundsteuer auf die Gewerbemieter und die Wohnungsmieter nach dem neuen Recht sinnlos. Zwar werden Mietwohngrundstücke – neben Einfamilienhäusern, Zweifamilienhäusern und Eigentumswohnungen – wie bei der Einheitsbewertung im Ertragswertverfahren bewertet. Auch im Ertragswertverfahren hat die Art der Nutzung aber keinen Einfluss auf die Höhe des Gebäudewertes. Denn nach der Anlage 39 zu § 254 BewG gelten Flächen, die zu anderen als Wohnzwecken genutzt werden, als Wohnflächen. Für diese Flächen wird die für Wohnungen mit einer Fläche unter 60 m² geltende monatliche Nettokaltmiete angesetzt.